By Kristin Y. Albrecht
This review discusses Julia Hänni’s book on legal philosophy, “Rechtsphilosophie in a nutshell”, a clear and well-structured introduction to central debates in legal philosophy that combines historical foundations with contemporary perspectives. The book stands out for its intercultural approach and for broadening the discussion beyond Europe, including a chapter on Asian legal philosophy.
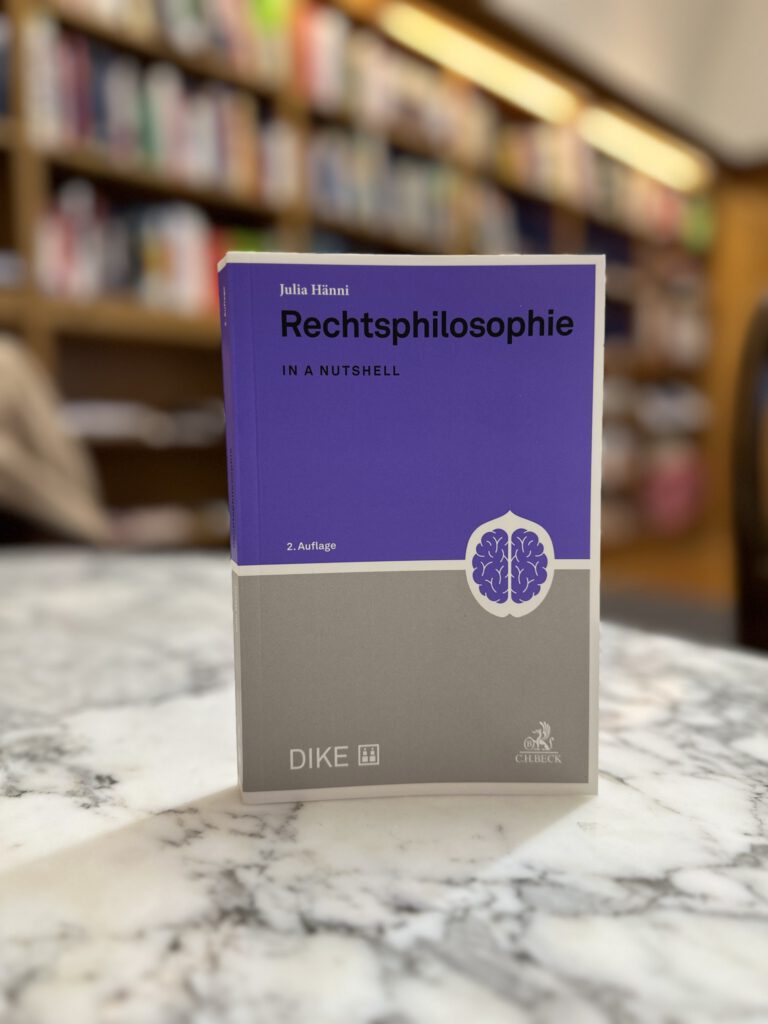
Julia Hänni hat mit der zweiten Auflage von Rechtsphilosophie in a nutshell (2025) ein kompaktes, zugängliches Werk geschaffen, das sich als Einführung in die Rechtsphilosophie präsentiert und dabei einige unerwartete Akzente setzt. Das ist auch der Knackpunkt bei all den Einführungen in die Rechtsphilosophie:[1] Worin genau liegt der Mehrwert für die Leserschaft?
Das Buchformat ist handlich, die Typografie und der Satz angenehm modern und das Gesamtwerk durch die nicht übertrieben eingestreuten Fotos, wie etwa von der griechischen Akademie, ästhetisch ansprechend. Auf Fußnoten wird praktisch durchgehend verzichtet, was den Lesefluss noch angenehmer macht und das Buch bei 284 Seiten hält, aber inhaltlich natürlicherweise zu weniger Präzision führt. (Zum Beispiel wenn das chinesische yi mit Gerechtigkeit gleichgesetzt wird, ohne die komplexe Diskussion hierzu andeuten zu können, 6.) Mit 58 Schweizer Franken (ca. 64 Euro) bewegt sich der Preis im Rahmen dessen, was Studierende in der Schweiz üblicherweise für ein Lehrbuch leisten. Soweit, so modern ist das Werk, doch wie steht es um den Inhalt?
Der Aufbau des Buches folgt einer chronologischen Gliederung und bietet zunächst keine Überraschungen: Der erste Teil behandelt ausführlich die Antike (wobei die zentraleuropäische Diskussion – selbst beginnend bei den Vorsokratikern – eingeordnet wird als eine Tradition neben derer in China, Indien und dem Orient, 78 S.), der zweite zu christlicher Philosophie (48 S.), der dritte zu rationalistischem Naturrecht (33 S.), ein vierter allein zu Kant (20 S., aber wo ist Hegel?) sowie einem fünften zu zentralen Konzepten des 20. und 21. Jahrhunderts (56 S.).
Das Werk widmet sich in erster Linie der Frage der Gerechtigkeit, deckt dabei jedoch letztlich ein deutlich weiteres Spektrum philosophischer, insbesondere rechtsphilosophischer Themen ab. Diese Breite ist zweifellos eine Stärke, da sie den Leserinnen und Lesern ein eindrucksvolles Panorama eröffnet und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten aufzeigt. Zugleich bringt sie es aber mit sich, dass die analytische Tiefenschärfe an einzelnen Stellen nicht voll entfaltet wird. So liegt der Schwerpunkt klar auf der Antike, die in großer Ausführlichkeit behandelt wird, während aus Sicht der Rezensentin das 20. und 21. Jahrhundert zu kurz kommen. Auch zeigt sich dies an einzelnen Beispielen, etwa wenn zwar die Radbruch’sche Formel erläutert, jedoch nicht auf Radbruchs Rechtsidee eingegangen wird. Wenn man der Einführung also etwas vorwerfen wollte, dann wäre es die allzu große Breite – die jedoch gleichzeitig ein guter Ausgangspunkt für weiterführende Studien bleibt. Gelungen sind die Episoden, in denen die Autorin die Theorie mit der Rechtspraxis verbindet, so beispielsweise um die postmoderne Kritik an Machtverhältnissen und ihre Anwendung in der Rechtsprechung zu medizinischen Heilbehandlungen (235–237).
Muss man das lesen? Ja – nicht zuletzt aufgrund des sechsten Abschnitts, der der asiatischen Rechtsphilosophie gewidmet ist. Hänni bietet hier eine fundierte Darstellung des Hinduismus und Buddhismus, die von den historischen und theoretischen Grundlagen des Buddhismus mit seinem Ziel der Aufhebung allen Leids bis hin zur japanischen Bioethik und deren Konsequenzen für Fragen der Organtransplantation reicht. Besonders hervorzuheben ist die Öffnung hin zu nicht-europäischen Perspektiven, die einen wichtigen Schritt über den nach wie vor dominierenden eurozentrischen Fokus hinaus markiert, welcher selbst aktuelle Lehr- und Einführungsbücher zur Rechtsphilosophie und den Grundlagen des Rechts prägt.
Auch an anderer Stelle eröffnet der Band Anknüpfungspunkte für weiterführende Überlegungen. Und auch bei der Lektüre finden sich immer wieder Einstreuungen. So beginnt §2 mit den Worten, dass das antike Griechenland „den Ursprung der europäischen und – im Gefolge der europäischen – auch der nordamerikanischen Philosophie“ ist. Dies wirft die Frage auf, weshalb gerade diese Strömungen aus dem globalen Reservoir philosophischer Traditionen in den Vordergrund gerückt werden. Im Vorwort wird auf den Forschungsaufenthalt der Autorin in Indonesien verwiesen, der ihr den Zugang zu asiatischen Philosophien eröffnet hat. Für künftige Auflagen ließe sich dies fruchtbar erweitern, etwa durch die Zusammenarbeit mit Co-Autorinnen, die in lokalen Traditionen verwurzelt sind, um die globale Vielfalt rechtsphilosophischer Ansätze noch umfassender sichtbar zu machen. Schließlich sei auf einen weiteren Aspekt hingewiesen: Während die als klassisch bekannten Denker – von Sokrates über Hobbes, Kant und Kelsen bis hin zu Rawls und Habermas – selbstverständlich prominent vertreten sind, bleiben Rechtsphilosophinnen bislang weitgehend unberücksichtigt. Auch hier bietet sich für zukünftige Auflagen die Chance, die Breite des philosophischen Diskurses deutlicher sichtbar zu machen.
Beide Aspekte sind nicht wichtig, weil es gerade dem Zeitgeist entspricht – der Koinzidenz kann sich die Rezensentin kaum erwehren – sondern weil ein Lehrbuch die Perspektive der Studierenden auf das Recht fundamental prägt. Das bedeutet Verantwortung. Hänni schreibt selbst, dass die
„philosophischen Positionen […] variable Perspektiven auf die Wirklichkeit und das Leben der Menschen in unsere[n] Verfassungsordnungen integrier[en] […]. Daraus ergibt sich ein offener Horizont, der wegführt von der Vorstellung der wissenschaftlichen Reflexion als eingleisigem Fortschrittsmodell, sondern vielmehr die Vielgestaltigkeit des Lebens und seiner juristischen Ordnungsprinzipien in sich sammelt […].“ (238 f.)
Und diese in einem Einführungslehrbuch vermittelte Perspektive – die den geforderten Mehrwert für die Leserschaft bietet – soll die Vielgestaltigkeit des Lebens und der Perspektiven darauf vermitteln, „ohne Kriterien für die Richtigkeitsintention aufzugeben“ (239). Mit ihrer Rechtsphilosophie in a nutshell zeigt Julia Hänni einen Weg, wie dies überzeugend gelingen kann. Es handelt sich um eine insgesamt gelungene Einführung, die insbesondere durch den Anspruch überzeugt, das rechtsphilosophische Denken über die Grenzen Europas hinaus zu erweitern.
[1] Allein in der Schweiz findet sich: Peter Forstmoser und Hans-Ueli Vogt, Einführung in das Recht, 5. Aufl. (Bern: Stämpfli, 2012); Karl-Ludwig Kunz und Martino Mona, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie: Eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft, 2. Aufl. (Zürich: Schulthess, 2012); Matthias Mahlmann, Konkrete Gerechtigkeit – Eine Einführung in Recht und Rechtswissenschaft der Gegenwart, 7. Aufl. (Baden-Baden: Nomos, 2024); ders., Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, 8. Aufl. (Baden-Baden: Nomos, 2024); Kurt Seelmann und Daniela Demko, Rechtsphilosophie, 7. Aufl. (München: C.H. Beck, 2019).